
Agitprop aus den Anden: Dort liegt auf einer unwirtlichen Hochebene die bolivianische Stadt Potosí; sie zählte im 17. Jahrhundert zu den größten der Erde. In ihrem Hausberg Cerro Rico wurde und wird Silber abgebaut – unter härtesten Bedingungen. Enorme Mengen des Edelmetalls wurden nach Spanien verschifft. Es finanzierte das siglo d´oro („Goldene Jahrhundert“) des Königreichs und damit den Aufschwung des entstehenden Kapitalismus in Nord- und Westeuropa, weil die Spanier ausgiebig Konsumgüter importierten.
Info
Das Potosí-Prinzip -
Wie können wir das Lied des Herrn im fremden Land singen?
08.10.2010 - 02.01.2011
täglich außer dienstags
11 - 19 Uhr
im Haus der Kulturen der Welt, Berlin
Katalog 29 €
Schrecken der Hölle
Deren Motive unterscheiden sich merklich vom Bilder-Kanon des Barocks, den die katholische Kirche während der Gegenreformation europaweit in Auftrag gab. Betont werden nicht Verheißungen ewigen Lebens, sondern Schrecken der Hölle. Mit einer Drastik, die ihresgleichen sucht: Da schinden Scharen von Teufeln die armen Seelen. Sie werden auf jede erdenkliche Weise gequält, während ihr Blut in Strömen fließt. Hier ist nicht Erbauung erwünscht, sondern Einschüchterung.
Interview mit Kuratorin Alice Creischer + Impressionen der Ausstellung
Die Indios, die zu Zehntausenden für die Minen zwangsrekrutiert wurden, sollten die unmenschliche Schufterei als Strafe für ihre Sünden verstehen: Manche der Folterwerkzeuge ähneln Bergbau-Gerät. So gewinnt der Barock, der heute als zuckrig vergoldeter Pomp-Stil voller Putten und Pathos gilt, in diesem Kontext seine ursprüngliche Bedeutung zurück: eine Propaganda-Kunst, die brutal indoktrinieren soll. Sie bildet ungeschönt ab, wie die Eroberer ihren Glauben mit Feuer und Schwert durchsetzen.
Anden-Barock
Herausragende Beispiele dieses so genannten Anden-Barocks hat das Kuratoren-Trio in Bolivien aufgespürt – meist waren sie in Europa noch nie zu sehen. Etwa die «Virgen del Cerro», die ein Unbekannter um 1720 malte: Die Jungfrau Maria erscheint auf dem Silberberg, der sie wie ein Mantel umhüllt, während koloniale Würdenträger sie anbeten. Oder das fast surrealistische Aquarell-Album, das Melchior Maria Mercado um 1850 schuf: Monströse Gestalten gehen bizarren Betätigungen nach.
Noch eindrucksvoller sind die Bilder, die nicht ausgeliehen werden durften, weil die bolivianischen Besitzer Diebstahl oder Fälschung fürchteten. Teils sind sie in der Schau durch Kopien vertreten, teils nur als Abbildungen im Katalog. So die «Hölle» von 1739 des Maestro de Caquiaviri, die alle Halluzinationen von Hieronymus Bosch weit übertrifft. Oder die «Arkebusen-Engel» von 1680 des Maestro von Calamarca: Seine Erzengel sehen wie Landsknechte aus und tragen Gewehre. Deutlicher hat sich die ecclesia militans nie entblößt.
Universelle Ausbeutung
Allerdings interessieren sich die Kuratoren kaum für die ästhetischen Eigenarten dieses Stils. Sie nutzen ihn nur als Beleg für ihre Generalthese vom universellen Ausbeutungszusammenhang: Wie Indios vor 400 Jahren entrechtet und ausgepresst wurden, so heutzutage Wanderarbeiter in China und den Golfstaaten. Dafür bieten sie ebenso beeindruckendes Anschauungsmaterial auf: Selbstzeugnisse und Video-Filme von Arbeitsunfällen, Unrecht und Protest in chinesischen sweatshops. Sowie Exponate des «Museum of Migrant Workers» in Peking, das dem leidenden Proletariat eine Stimme geben will – sinnigerweise sind sie in die Zentrale der IG Metall ausgelagert.
Gegen die Wucht dieser authentischen Dokumente verblassen die meisten Werke zeitgenössischer Künstler, die sie ergänzen und kommentieren. Wie das Beiwerk, das die Macher dem Besucher mitgeben: Ein Kurzführer, der mit einer Schnitzeljagd kreuz und quer durch die Räume alles haarklein beschreiben will, aber nur Verwirrung stiftet. Sowie ein Katalog, der sämtliche historischen und ökonomischen Bezüge klären will und völlig konfus ausfällt.
Ungerechte Weltordnung
Diese Ausstellung ist entschieden links und begeht alle traditionellen Fehler der Linken. Sie ist auf Machtverhältnisse und Warenströme fixiert, theorielastig und redundant. Mit einem immensen begrifflichen Aufwand kommt sie nur zum Schluss, dass die Weltordnung verdammt ungerecht ist. Doch das macht nichts: Der faszinierende Bilder-Kosmos, den die Schau versammelt, spricht höchst beredt seine eigene Sprache – ganz ohne Worte.
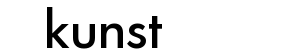

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.