
«Long time no see»: Wenn Thais mit diesem Satz Touristen empfangen, dann übersetzen sie eine thailändische Grußformel wortwörtlich ins Englische. Was für denjenigen seltsam klingt, der nur Schul-Englisch kennt. Wobei der freundlich gemeinte Sinn der Wendung nicht verloren geht – auch im Deutschen ist die Begrüßung «Lange nicht mehr gesehen» zwar unüblich, aber nicht abweisend.
Info
Found in Translation
28.01.2012 - 09.04.2012
täglich 10 bis 20 Uhr im Deutsche Guggenheim, Unter den Linden 13/15, Berlin
Englisch ist nicht mehr allein die Nationalsprache des angelsächsischen Kulturkreises, sondern längst eine globale lingua franca – und wird weltweit von Sprechern ihren lokalen Gewohnheiten und Bedürfnissen angepasst. Diese Abweichungen bemerkt nur, wer BBC English beherrscht. Andere nehmen sie kaum wahr, solange sie sich irgendwie verständigen können: Die populärste Weltsprache ist nicht Englisch, sondern Bad English.
Werbung für Whisky in Japan
Solche Phänomene von Verschiebung und Kreolisierung im Prozess der Übersetzung sollen Werke von neun Künstlern belegen, die im Deutschen Guggenheim zu sehen sind. Der Titel der Schau spielt auf den Autorenfilm «Lost in Translation» von Sofia Coppola an. Die handlungsarme Story über Bill Murray, der Werbe-Spots für Whisky in Japan dreht und sich dort völlig verloren fühlt, wurde 2003 zum Überraschungs-Erfolg: Offenbar erkannten sich viele Kinogänger im Hollywood-Star wieder, der von fernöstlicher Fremdheit irritiert wird.
Impressionen der Ausstellung
Besser als Verse vom gangsta rapper
Diese Identifikation dürfte Ausstellungs-Besuchern schwer fallen. Fast alle gezeigten Arbeiten sind zu textlastig und voraussetzungsreich, um intuitives Verständnis zu erlauben – weil sie exzellente Englisch-Kenntnisse oder Vertrautheit mit dem Material erfordern. Etwa das Video «Foe» von Brendan Fernandes: Darin liest er eine Passage aus dem Klassiker «Robinson Crusoe» von Daniel Defoe laut vor. Dabei versucht er, Akzente von Kanadiern, Indern und Kenianern zu imitieren – wer außer solchen Landsleuten soll das erkennen?
Wie Englisch von jungen Chinesen zu «Chinglish» verballhornt wird, will O Zhang darstellen. Indem er Teenager in street wear vor Monumenten fotografiert und mit kommunistischen Propaganda-Parolen untertitelt, damit der kulturelle Abstand ins Auge springt. Doch seine Arrangements funktionieren nicht: T-Shirt-Slogans wie «It’s all good in the hood» oder «Don’t fuck with us, we play hard» mögen aggressiv-banal wie hip hop rhymes sein, aber sie sind grammatikalisch einwandfrei – zumindest besser als das, was gangsta rapper von sich geben.
Passanten ignorieren Protest-Plakate
Andere Beiträge handeln von der Unmöglichkeit einer Übersetzung, die nicht kontext- oder situationsabhängig wäre. Alejandro Cesarco hängt zehn englische Ausgaben von Dantes «Göttlicher Komödie» auf, die sich stark unterscheiden – so what? Matt Keegan lässt seine Mutter Spanisch-Vokabeln aufsagen und blendet selbst gebastelte Symbol-Kärtchen ein. Sie zeigen die Lebenswelt einer US-Hausfrau in den 1980er Jahren – wie aufregend!
Siemon Allen klebt zwei Versionen eines Tim-und-Struppi-Comics nebeneinander: Die erste Fassung von 1939/40 spielt auf die damalige Lage in Palästina an, die zweite hat Zeichner Hergé 1948 in ein Fantasieland verlegt. Autoren ändern ihre Werke je nach Großwetterlage: welche Überraschung! In einer Dia-Serie von Sharon Hayes hält die Künstlerin auf der Straße angestaubte Protest-Plakate hoch; alle Passanten ignorieren sie – sensationell!
Sämtliche Exponate verfehlen, das Eigentümliche von Übersetzungsleistungen deutlich zu machen: die Auswahl zwischen Alternativen und das subtile Abwägen, welche davon warum vorzuziehen wäre. Damit bleibt der Ansatz dieser Ausstellung in der bloßen Behauptung stecken – kein glücklicher Fund, nirgends.
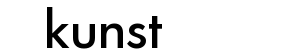

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.