
Bacons Studien in expressivem Kubismus
Auerbach, gebürtiger Berliner jüdischer Herkunft, kam als Achtjähriger nach England. Er zeichnete und malte unermüdlich dieselben Personen und Ansichten, wobei er seine Bilder dutzendfach überarbeitete: Gesichter sind abgewandt in sich gekehrt, Figuren zerbröseln in schrundigen Farbflächen, Straßen und Häuser fließen ineinander – doch die Formen bleiben stets unterscheidbar.
Francis Bacon, wohl der bedeutendste britische Künstler des 20. Jahrhunderts, fand früh zu seinem unverkennbaren Stil: verdrehte Körper mit deformiertem Antlitz in klaustrophobisch kahlen Räumen. Allein wegen der zehn hier versammelten Werke lohnt ein Besuch: Beim Vergleich wird deutlich, wie viele Nuancen Bacon mit seinen Mutanten auszudrücken vermochte. Manche verströmen rohe Energie, andere wirken wie von Dämonen gequält. Oder wie Studien in expressivem Kubismus: mit etlichen Gefühlsregungen gleichzeitig.
Selbstporträt als Wackelbild
Auf den ersten Blick konventioneller erscheinen die tableaux von Michael Andrews: Er malte bevorzugt Gruppenporträts, in denen die Akteure allerdings seltsam vereinzelt auftreten. Im sechs Meter langen Triptychon „Good and Bad at Games“ (1964/68) erscheinen sie als Schemen vor der Kulisse eines Luxushotels bei Nacht: erst vollständig, dann in verschiedenen Stadien der Auflösung – ein sarkastischer Kommentar zu Abendgesellschaften, die aus dem Ruder laufen.
Zu dieser Zeit hatte sich eine britische Variante der Pop Art herausgebildet – zu der sich allerdings keiner ihrer Vertreter rückhaltlos bekennen wollte. Ihr Nestor Richard Hamilton wechselte häufig die Technik: Er schmähte einen Labour Party-Politiker als Masken-Monster, schuf ironische Collagen und sogar ein Selbstporträt als Wackelbild („Palindrome“, 1974).
Motiv aus Urschlamm herausmodelliert
Der 15 Jahre jüngere David Hockney wurde in den 1970ern mit sonnigen Kalifornien-Sujets, etwa drahtigen Jünglingen im swimming pool, zum Postervorlagen-Lieferanten. Hier ist vor allem sein Frühwerk zu sehen: erratische Gestalten in unklaren Situationen vor blankem Hintergrund. Sein Freund R.B. Kitaj kultivierte ebenso eine mehrdeutige Bildsprache: Da tummelt sich vielköpfiges Personal in Konstellationen, die zahlreiche Anspielungen auf Kunst- und Geistgeschichte enthalten.
Hintergrund
Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "David Hockney: A bigger Picture" - Retrospektive im Museum Ludwig, Köln
und hier eine Besprechung der Ausstellung "Ludwig goes Pop" - mit Werken von Richard Hamilton im Museum Ludwig, Köln
und hier einen Bericht über die Ausstellung "R.B. Kitaj (1932 – 2007) Obsessionen" - Werkschau im Jüdischen Museum Berlin + Hamburger Kunsthalle
Illusionslos ohne verstiegene Theorien
Was verband diese Künstler außer ihrem Wohnort? Zunächst nur, dass Kitaj 1976 für eine Ausstellung in der Hayward Gallery den Begriff „School of London“ prägte. Damit erhielt diese figürliche Malweise ein griffiges label, deren wichtigste Vertreter längst international einflussreich waren: in Deutschland etwa auf Künstler wie Georg Baselitz, Anselm Kiefer und Jörg Immendorff.
Von Schubladen abgesehen, wird in dieser Schau aber auch ein spezifischer spirit deutlich: konsequente Orientierung an sichtbarer Wirklichkeit, Aufmerksamkeit für das Alltägliche, nie erlahmendes Interesse am menschlichen Dasein – eben „das nackte Leben“. Es war eine illusionslose Kunst ohne verstiegene Theorien, die drei Jahrzehnte lang in London entstand – bis der hype um Young British Artists und den Turner Prize sie nach 1980 zum show business degenerieren ließ.
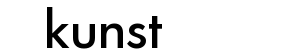

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.