
Der erste und älteste Bart ist der schönste. Er ist im Atrium des Neuen Museums auf einem fast 3000 Jahre alten Alabaster-Relief zu sehen, das wegen seiner Größe am angestammten Platz bleiben musste. König Assurnasirpal II. im Zweistromland trägt diesen Vollbart: aus fein gedrehten Löckchen auf den Wangen geht er in einen langen Haar-Keil über, der vierfach abwechselnd wellig geflochten und gelockt ist.
Info
Bart - zwischen
Natur und Rasur
11.12.2015 - 03.07.2016
täglich außer montags
10 bis 18 Uhr
im Neuen Museum, Bodestrasse, Berlin
Im Dickicht der Haare
09.10.2015 - 20.03.2016
täglich außer montags
10 bis 18 Uhr,
freitags bis 20 Uhr
in der Grimmwelt, Weinbergstraße 21, Kassel
Archäologie trifft Zeitgeist
Mit dieser Ausstellung gelingt dem Museum das Kunststück, aus seiner Archäologie- und Vorderasien-Sammlung ein Thema zu destillieren, das sich mit dem Zeitgeist kurzschließen lässt – der ist so bärtig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Da lohnt ein Rückblick zu den Anfängen: Bereits vor 5000 Jahren wurden langrechteckige Feuerstein-Messer hergestellt, die gut zum Rasieren taugten.
Bärtige Griechen, rasierte Römer
Keine Frage: Kulturmenschen kümmerten sich seit jeher um ihre Gesichtsbehaarung. Wild wuchernde Zottelbärte waren in Mythologie und frühen Chroniken Erkennungszeichen für Gott Pan, Faune und Satyrn, Waldwesen und Barbaren. Bart als stolze Mannestracht gerne – aber gepflegt muss er sein: Mykener trugen ihn dreigeteilt, Spartaner am Kinn, Athener als Vollbart. Ohne ihn – leicht strähnig gekämmt – wären Sokrates oder Platon auf Marmorbüsten kaum zu erkennen.
Mit diesem Würdezeichen brach Alexander der Große; er läutete das Zeitalter der glatt rasierten Römer-Herrscher ein. Ob Caesar, Augustus oder Nero: kein Härchen kitzelte ihr Kinn. Erst Kaiser Hadrian eiferte Anfang des 2. Jh. den griechischen Philosophen nach; sein akkurat gestutzter Vollbart war mehr als 100 Jahre lang stilbildend. Mitte des 4. Jh. verteidigte Kaiser Julian seine Barttracht gegen Spötter sogar mit einer Satire: „Der Bart soll eigentlich mein unschönes Gesicht verdecken. Doch er macht alles schlimmer: Läuse tummeln sich in ihm, er hindert mich am Essen, und Küssen ist unmöglich.“
Impressionen der Ausstellung "Bart – zwischen Natur und Rasur"
Bart-Parade der Alten Welt
Solche Selbstironie in Sachen Bart ist selten; meist regiert heiliger Ernst. Radikalreformer wie Zar Peter der Große oder Mustafa Kemal Atatürk ließen alte Bärte abschneiden; wer sich nicht davon trennen wollte, musste Strafe zahlen. Dagegen ließen im 19. Jh. Freidenker wie Karl Marx oder Auguste Rodin ihre Rauschebärte unbekümmert sprießen – als Ausweis ihrer Individualität. Und Rasur-Abstinenz sparte Zeit.
So ist auch diese Bart-Parade angelegt. Sie reiht schöne Beispiele seit der Antike in bunter Folge aneinander, meidet aber den Blick über den europäisch-nahöstlichen Rasierschüssel-Rand: zwei indische Miniatur-Malereien müssen für Asien, ein paar Fotos für Lateinamerika herhalten. Ob und warum außerhalb der Alten Welt Männer Bart tragen, bleibt offen.
Conchita Wurst als Mondsichel-Madonna
Ebenso die haarigen Fragen, die damit verfilzt sind. Weshalb präsentieren sich Mächtige in manchen Epochen bärtig, in anderen aber bartlos? Wie kommt es, dass der Rauschebart, lange als hinterwäldlerisch verachtet, ausgerechnet im förmlichen bürgerlichen Zeitalter zum Markenzeichen von Original-Genies wird – ein Vorbild für Protestler von den Lebensreformern bis zu Hippies und Rastafaris? Dazu fallen den Kuratoren nur wenige Sätze über „kontinuierlich sich ändernde Bartmoden“ ein; sie machen es sich arg einfach.
Stattdessen widmen sie ein ganzes Kabinett genderpolitisch korrekt dem Phänomen Bart tragender Frauen. Die gibt es natürlich, wie auch schwarze Schafe, weiße Raben und die bärtige Conchita Wurst, die 2014 den „European Song Contest“ gewann; der Berliner Bildhauer Gerhard Goder stellt sie geschmackvollerweise als lebensgroße Madonna auf der Mondsichel dar.
Interview mit Programmleiterin Susanne Völker + Impressionen der Ausstellung "Im Dickicht der Haare"
Letztes Refugium der Männlichkeit
Indem die KuratorInnen den Bart zum beliebigen lifestyle accessoire zurechtstutzen und dafür allerlei amüsante gadgets zusammentragen, verstellen sie jede Einsicht in die Gründe des aktuellen Bart-Booms. Es liegt nahe, ihn als kulturelles Rückzugs-Gefecht der heutigen Jungmänner-Generation zu deuten. Verbindliche Geschlechterrollen sind perdu, allmählich schleifen Frauen alle maskulinen Bastionen – aber Bärte sind ein Männlichkeits-Merkmal, das keine den Trägern nehmen kann. Außer Conchita Wurst.
Etwas tiefer in das komplizierte Geflecht aus Frisuren und kultureller Praxis dringt die Ausstellung „Im Dickicht der Haare“ in der Kasseler „Grimmwelt“ ein. Sie soll seit September 2015 in einem aufwändigen Neubau Leben und Wirken der Brüder Grimm vermitteln; dafür rückt sie nicht deren Märchen in den Mittelpunkt, sondern ihr Mammutwerk „Deutsches Wörterbuch“.
Haarig verflochtenes Freundschafts-Band
Darin kommen fast 280 Wortkombinationen mit „Haare“ vor; für Leiterin Susanne Völker Grund genug, sie zum Gegenstand der ersten Sonderschau zu machen. Nun ja – mit derselben Begründung böten sich vermutlich Hunderte anderer Stichworte aus dem 32-bändigen Riesen-Lexikon an, aber warum nicht: Haare hat, im Gegensatz zu Bärten, wirklich jeder.
Die wallende Pracht wird in acht Themen-Strängen zurechtgekämmt: Manche, wie „Flechten“ und „Scheren“, leuchten unmittelbar ein; andere, wie „Archivieren“ und „Verwandeln“ weniger. Dabei finden die Kuratorinnen für alle Abteilungen glänzende Beispiele. Haar-Reliquien, abgeschnittene Locken und mit Echthaar verziert Porträt-Karten flechten Bänder der Freundschaft und des Gedenkens an Verstorbene.
Magisches headbanging-Ritual
Hintergrund
Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "Homosexualität_en" über Geschlechterverständnis + -bilder im Deutschen Historischen Museum + Schwulen Museum, Berlin
und hier eine Besprechung der Ausstellung "Gottfried Lindauer: Die Māori Portraits" mit außergewöhnlichen Haartrachten aus Neuseeland in der Alten Nationalgalerie, Berlin
und hier einen Bericht über die Ausstellung „Auf den Spuren der Irokesen“ über die Erfinder der Irokesen-Frisur im Martin-Gropius-Bau, Berlin
und hier einen Beitrag über die Ausstellung “Momente des Selbst” mit Fotografien exzentrischer afrikanischer Frisuren in The Walther Collection, Neu-Ulm.
Dieses magische headbanging-Ritual verweist auf die elementare Verbindung von Haaren und Macht. Haare sprießen unaufhörlich: Ihr ständiger Wuchs ist eine natürliche Kraft, die nichts unterbinden kann. Wie élan vital oder Libido; deshalb ist bei vielen mythischen Helden die Körperkraft oder Potenz in den Haaren verortet. Werden jene gestutzt oder abgeschnitten, geht diese verloren.
Nächste Sonderschau über Glatze
Dieser Zusammenhang erklärt viele Praktiken der Haar-Kontrolle. Verhüllen und Verschleiern erscheinen geboten, wenn langes, fließendes Haar einer Frau als Ausdruck ihrer erotischen Energie aufgefasst wird. Bei vielen Initiationsriten, von Naturvölkern über Klöster bis zur Armee, verliert der Novize das Haupthaar: Man erniedrigt und entrechtet ihn symbolisch, bevor er in eine neue Gemeinschaft aufgenommen wird.
All das wird in der Ausstellung nur angedeutet. Sie fächert die universelle Symbiose der Menschheit mit ihren Haaren allenfalls punktuell auf. Es ist wie bei einem Modell-Journal, das man beim Friseur rasch durchblättert, ohne zu ahnen, welch Aufwand und Aussage in jedem Haarschnitt steckt. Vielleicht sollte sich die Grimmwelt für die nächste Sonderschau ein leichter fassliches Stichwort vornehmen: Wie wäre es mit „Glatze“?
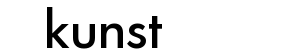

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.