
Biennalen sind heutzutage die Rummelplätze im internationalen Kunstbetrieb. Jede Regionalmetropole, die etwas auf sich hält, leistet sich eine: Diese Spektakel sind vergleichsweise günstig und verpflichten zu nichts – außer, sie alle zwei Jahre zu wiederholen. Mit dem Prestige, das die Mutter aller Biennalen in Venedig immer noch ausstrahlt, locken sie zuverlässig zahlungskräftige Kulturtouristen an.
Info
10. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst - We don’t need another hero
09.06.2018 - 09.09.2018
täglich außer dienstags
11 bis 19 Uhr,
donnerstags bis 21 Uhr
in der Akademie der Künste, Pariser Platz 4;
+ KW Institute for Contemporary Art (KunstWerke), Auguststr. 69;
+ Volksbühne Pavillon, Linienstraße 227;
+ ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik, Siemensstraße 27, Berlin
Katalog 25 €; Kurzführer 5 €
Spielplatz für zweitrangige Kuratoren
Welche Daseinsberechtigung diese Veranstaltung haben könnte, außer den sommerlichen Eventkultur-Kalender der Hauptstadt anzureichern, wurde nie recht deutlich. Weder gelang es der Berlin Biennale, Trends zu setzen oder zu veranschaulichen, noch, viel versprechende Nachwuchskünstler bekannt zu machen.
Sie wirkte eher wie ein Spielplatz für überambitionierte, aber zweitrangige Kuratoren, die es mit ihren nebulösen Theorie- und Konzept-Gespinsten auf die wichtigen Bühnen nicht schaffen. Oder dort scheitern sollten: Auch Adam Szymcyzk, der im Vorjahr die documenta 14 in den Sand setzte, war 2008 Chef der 5. Berlin Biennale gewesen.
Impressionen der Ausstellung in der Akademie der Künste, dem Zentrum für Kunst und Urbanistik sowie den KW
Hauptkuratorin aus Südafrika
Das ändert sich allmählich. Zur Volljährigkeit der Berlin Biennale vor zwei Jahren legte das New Yorker Kollektiv DIS als Leitung einen Auftritt hin, bei dem erstmals die Ausgangsthese überzeugte: Kunst als Medium von System- und Kapitalismuskritik muss ihre Kritik in Formaten vortragen, die ins durchökonomisierte Geschäft mit der Kunst passen – ein Widerspruch in sich, dessen Facetten darzustellen sich lohnt. Das geschah zwar mit bigger is better-US-Mentalität leicht größenwahnsinnig; etwa auf einem umgebauten Schiff oder mit einer Miniatur-Eisenbahn, die eine ganze Halle füllte, sowie überbordendem Merchandising-Shop. Aber immerhin: Diese Schau hatte ein aktuelles Thema.
Auch die 10. Berlin Biennale hat eine Grundidee, die relevanter kaum sein könnte: ganze Kunst-Kontinente in den Blick zu nehmen, die man bislang hierzulande weitgehend ignoriert hat. Als Hauptkuratorin wurde die Südafrikanerin Gabi Ngocobo berufen, die 2015 einen Rückblick auf Protestkunst aus ihrer Heimat im Frankfurter Weltkulturen Museum gestaltete. Ngocobo hat ein junges, vierköpfiges Team um sich geschart: Drei Mitglieder sind afrikanischer Herkunft, einer ist Brasilianer – und alle sind vorwiegend an westlichen Kunstinstitutionen tätig.
Halb Potsdam-Park, halb Haiti-Palais
Wie die von ihnen eingeladenen Künstler: Sie kommen aus allen möglichen Weltgegenden von Haiti bis Benin und Kuba bis Zimbabwe – aber wohnen meist in Paris, London oder New York, wo die wichtigsten Galeristen und Stipendien-Vergabestellen sitzen. Oder gar im Nirgendwo: „Lebt und arbeitet an verschiedenen Orten“, gibt der Mexikaner Oscar Murillo an. Solch aufgesetztes Weltbürgertum, das seine Herkunft wolkig verschleiert, wirkt etwas bemüht angesichts von künstlerischen Anliegen, die sehr konkret aufs Hier und Jetzt zielen.
Angefangen mit dem Auftakt: Endlich beherzigt die Berlin Biennale, dass ihre über ein halbes Dutzend Standorte im Stadtgebiet verstreute Ausstellung einen visuellen Ankerpunkt braucht. Der steht vor der Akademie der Künste: ein monströser Block Ruinen-Romantik; halb Architektur-Fragment, halb Theater-Kulisse. Die Dominikanerin Firelei Báez hat den Klotz aus Pappmaché gestaltet – auf der einen Seite als Fragment der Grotte im Potsdamer Park von Schloss Sanssouci, auf der anderen als Zitat des „Palais Sans-Souci“ auf Haiti, das sich König Henri Christophe 1810/3 erbauen ließ. Augenfälliger lassen sich Jahrhunderte alte kulturelle Verbindungen zwischen Europa und seinen Ex-Kolonien kaum demonstrieren.
Fingierte Thron-Ausgrabung
Im Inneren der Akademie breitet Baéz dieses Sujet auf Dutzenden von Collagen aus: mit Karten und Buchseiten aus alten Folianten, die sie so prächtig wie rätselhaft übermalt – ähnlich den vieldeutig schillernden Collagen der Kenianerin Wangechi Mutu. Andere Künstlerinnen stricken Motive indigener Kunst weiter. Die in Sansibar geborene Britin Lubaina Himid knüpft an kongolesische Kanga-Tücher an, deren Stoffe bunt mit Lebensweisheiten bedruckt sind. Diese ersetzt Himid auf ihren Acryl-Bildern durch poetische oder ironische Textzeilen.
Einen schwelenden Konflikt im Kontext der anschwellenden Raubkunst-Debatte verwandelt Thierry Oussou aus Benin in eine Kunstaktion: Der westafrikanische Kleinstaat streitet mit seiner früheren Kolonialmacht Frankreich um die Herausgabe des Thrones des letzten historischen Königs von Dahomey. An der damaligen Goldküste verkörperten solche Thronstühle sakrale Machtfülle: So händigten die Ashanti in Ghana 1900 den englischen Eroberern eine heimlich angefertigte Kopie aus, um das Original behalten zu können. Ein Trick, der in Benin nicht gelang – vor zwei Jahren fingierte Oussou die Ausgrabung eines Nachbaus, um auf den fortdauernden Verlust des Nationalsymbols aufmerksam zu machen.
Suggestive Geheimbund-Bilder
Hintergrund
Lesen Sie hier eine Rezension der "9. Berlin Biennale - The Present in Drag" in Berlin 2016
und hier eine Besprechung der "8. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst" in Berlin 2014
und hier einen Bericht über die "7. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst" in Berlin 2012
und hier einen Beitrag über die Ausstellung "Solch ungeahnte Tiefen - This undreamt descent" - beeindruckende Werkschau der Kenianerin Wangechi Mutu in der Kunsthalle Baden-Baden.
Solche Suggestivkraft haben nur wenige Exponate. Vieles bleibt diffus oder verwässert durch Wiederholung: etwa die weiträumig verteilten Aquarelle der Chilenin Johanna Uzueta, deren filigrane Rosetten arg folkloristisch-kunsthandwerklich anmuten. Ohnehin wird die etablierte Unsitte, ganze Räume mit Arbeiten nur eines Künstlers zu füllen, auch diesmal fortgeschrieben, insbesondere im Gewerbebau des „Zentrums für Kunst und Urbanistik“: als sei es die Aufgabe dieser Gruppenausstellung, einzelnen Teilnehmern jeweils eine Mini-Werkschau auszurichten.
Keine Kunst-Helden nötig
Ebenso weitergeführt wird der unselige Brauch, jede Menge „ortsspezifische Installationen“ in Auftrag zu geben – mit solchen meist großzügig dotierten Blankoschecks wissen viele Empfänger nichts Interessantes anzufangen. Was in den KW (ex-KunstWerken) zu besichtigen ist: Die riesige Freifläche im Erdgeschoss füllt die Südafrikanerin Dineo Seshee Bopape mit einer Trümmerwüste aus Bauschutt und beliebigen Zutaten. Nebenan gibt die Brasilianerin Fabiana Faleiros Nachhilfe beim Masturbieren: Ihre kahle „Mastur Bar“ mit Neon-Funzeln und Disco-Gestöhne à la Donna Summer wirkt so animierend wie eine Fernfahrer-Kaschemme im Sertão, dem brasilianischen Hinterland.
Doch insgesamt hat diese Ausgabe einige Kinderkrankheiten früherer Berlin Biennalen abgelegt. Wie der Titel „We don’t need another hero“ nahelegt, kommt sie angenehm unprätentiös daher – und bietet stattdessen etwas, das im überfüllten Kunstgewusel und -gewese der Hauptstadt bislang meist zu kurz kam: spannende Einblicke in die Gegenwartskunst nichtwestlicher Weltgegenden.
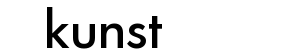

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.