
Ikonen im Dutzend billiger: Das Modewort „ikonisch“ wird inzwischen fast wahllos benutzt. Alles Mögliche soll damit aufgewertet werden: von Architektur und Design über Stars und Sternchen bis zu Konsumgütern aller Art. Was nur denkbar ist, weil echte Ikonen in säkularisierten Gesellschaften ihre Funktion verloren haben; Andachtsbilder dienen immer seltener dem Gebet. Ihre transzendente Aura wird nun von allerlei Profanem in einer Art Bedeutungs-Vampirismus aufgesogen.
Info
Ikonen - Was wir Menschen anbeten
19.10.2019 - 01.03.2020
täglich außer montags
10 bis 18 Uhr,
dienstags bis 21 Uhr
in der Kunsthalle, Am Wall 207, Bremen
Begleitheft gratis,
Katalog 35 €
Aura ohne Ablenkung
Das ist ein fast unüberschaubar facettenreiches Thema. Um es in eine Ausstellung zu packen, treibt die Bremer Kunsthalle enormen Aufwand. Mit einem kühnen Kunstgriff: Sie hat das gesamte Haus leer geräumt und präsentiert in 60 Räumen jeweils nur ein einziges Exponat – auf dass seine auratische Kraft konzentriert auf den Betrachter wirken möge.
Feature zur Ausstellung. © Kunsthalle Bremen
Wenig Sakralkunst, viele Zitate
Dafür greift der Titel „Ikonen – Was wir Menschen anbeten“ eigentlich zu kurz. Es geht weniger um herkömmliche Kultbilder als vielmehr darum, wie sich die Aufladung von Artefakten mit Bedeutung im Lauf der Zeit entwickelt und verändert hat. Deshalb hält sich die Schau mit Sakralkunst im engeren Sinne nicht lange auf: eine russische Ikone, ein mittelalterlicher Reliquien-Schrein, eine Frührenaissance-Madonna, ein barockes Franziskus-Bild und „Ecce Homo“ von 1821 – das war’s.
Die übrigen Räume füllen Werke der klassischen Moderne und zeitgenössischen Kunst, die auf markante Weise die Motive und das Prestige religiöser Bildproduktion zitieren, fortschreiben – oder auch parodieren. Etwa als Künder einer neuen Formenwelt: Kasimir Malewitsch platzierte sein „Schwarzes Quadrat“ 1915 in genau der Zimmerecke unter der Decke, wo in russischen Haushalten traditionell die Heiligen-Ikone hängt. Wassily Kandinsky wollte mit abstrakten Kompositionen eine Art Epiphanie erzeugen: „Der Heilige Geist ist nicht gegenständlich zu erfassen, sondern nur ungegenständlich.“
Joseph Beuys ist bereits unsterblich
Ähnliche Erfahrungen sollte die Farbfeldmalerei von US-Künstlern wie Barnett Newman und Mark Rothko oder die Monochromie des Franzosen Yves Klein auslösen: die Leuchtkraft reiner Farben als spirituelles Erlebnis. Daran schließt heutzutage James Turrell an, der komplette Räume mit diffusem Farblicht füllt – Erleuchtung durch Eintauchen. Oder der japanische Fotograf Hiroshi Sugimoto: Seine Schwarzweiß-Aufnahmen der Weltmeere laden zur Reflexion über das zeitlose Walten der Elemente ein.
Wer Ewigem nachspürt, verleiht sich oft selbst höhere Weihen. Vincent van Gogh porträtierte sich als Schmerzensmann mit angedeutetem Nimbus in der imitatio Christi. Joseph Beuys erklärte jede Aktion zur künstlerischen Tat; auf die Frage, ob er unsterblich werden wolle, antwortete er: „Ich bin es bereits.“ Marina Abramović walzt in Performances alltägliche Handlungen exzessiv aus und stilisiert sich damit zur Grenzerfahrungs-Märtyrerin.
Hip-Hop-Tänzer im Goldrahmen
Andere bedienen sich bei religiösen Bildformeln für sehr diesseitige Zwecke: Katharina Fritsch mokiert sich mit einer quietschgelben Gipsmadonna über Sakral-Kitsch. Noch ungenierter geht der US-Künstler Kehinde Wiley vor: Er porträtiert Schwarze wie den Hip-Hop-Tänzer Malak Lunsford fotorealistisch in ihrem aktuellen Outfit – aber in Posen von Heiligen oder Renaissance-Fürsten, eingefasst in gotisch anmutende Goldrahmen. So wird jeder Promi im Nu zum imponierenden Altmeister-Idol.
Hintergrund
Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "Modern Icons – Malerei aus der Sammlung Ludwig" - interessante Themen-Schau im Ludwig Forum, Aachen
und hier eine Besprechung der Ausstellung "Kraftwerk Religion – Über Gott und die Menschen" - facettenreiche Schau im Deutschen Hygiene-Museum, Dresden
und hier einen Bericht über die Ausstellung "zeigen, verhüllen, verbergen – Schrein" - Themen-Schau "zur Ästhetik des Unsichtbaren" im Kolumba, Kunstmuseum des Erzbistums Köln
und hier einen Beitrag über die Ausstellung "James Turrell" - große Werkschau des Lichtkünstlers im Museum Frieder Burda, Baden-Baden
und hier eine Kritik des Films "Beuys" - Doku-Porträt des Aktionskünstlers aus Archivmaterial von Andreas Veiel.
40 Stimmen in 40 Boxen
Solche Trivialisierung entwertet auch Arbeiten, die tatsächlich Schauer des Ergriffenseins hervorrufen können. In der Klanginstallation von Janet Cardiff wird eine Renaissance-Motette von 40 Sängern vorgetragen. Jede Stimme erklingt aus je einem Lautsprecher; diese geistliche Musik hört sich an jeder Stelle im Raum anders an. Ähnlich hypnotisch wirkt die Installation „Lapis“ von James Whitney: Er filmte 1966 mit unzähligen Punkten bemalte und rotierende Glasscheiben. Untermalt von Raga-Melodien, erscheinen sie wie Mandalas zur Meditation.
Allein durch seine schieren Ausmaße überwältigt das wandfüllende Gemälde des dänischen Künstlers Alexander Tovborg. Die komplexe Komposition „Mann und Jeanne d’Arc (Das Gleichgewicht)“ in giftigen Neonfarben erinnert mit ihrer schroffen Symmetrie an altamerikanische Monumental-Reliefs – Ehrfurcht gebietend, da kaum zu entschlüsseln.
Kuratoren als Hohepriester
In dieser Panorama-Schau über den Sinntransfer von Religion zu Kunst fehlt nur ein Exkurs zur Rolle von Kuratoren: Wie Hohepriester weihen sie Werke mit Renommee und dekretieren Interpretationen in einem Jargon, der Laien meist unverständlich bleibt. Mit Erfolg: Solange das Publikum ihm glaubt, herrscht der Kunstbetriebs-Klerus unangefochten.
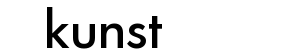

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.