
Warum Kunst bestaunen, anstatt sich in sie zu verwandeln? Selbststilisierung zum lebenden Kunstwerk war das Ziel der ersten Dandys, die um 1800 anfangs in England, dann im übrigen Europa auftauchten: als Gegenreaktion auf die Uniformität des Bürgertums, das allmählich die Macht übernahm. Während Biedermeier-Honoratioren nur dunkle Anzüge trugen, orientierten sich Dandys an der schillernden Mode der Aristokratie. Sie schmückten sich mit Korsett, eleganten Halstüchern und Knopfleisten; die blaue Blume der Romantiker steckten sie ins Knopfloch.
Info
Am I Dandy? Anleitung zum extravaganten Leben
24.06.2016 - 20.11.2016
täglich außer dienstags
14 bis 18 Uhr,
donnerstags bis 20 Uhr,
samstags bis 19 Uhr
im Schwulen Museum, Lützowstr. 73, Berlin
Leben als Bühne inszenieren
Zur angestrebten Geistesaristokratie gehörten auch erlesene Umgangsformen: Bekannte Dandys wie Lord Byron, Fürst Hermann von Pückler-Muskau, Charles Baudelaire und später Oscar Wilde waren berühmt für Eleganz und Witz, Ironie und Snobismus. Öffentliche Selbstdarstellung stand im Zentrum ihres Daseins: Obwohl Wildes Theaterstücke mit geschliffenen Aphorismen gespickt waren, blieben sie ihm zufolge als Inszenierungen stets hinter der seines eigenen Lebens zurück.
Interviews mit den Kuratoren Julia Bertschik + Michael Fürst + Impressionen der Ausstellung
Kleider-Auswahl wie beim Herrenausstatter
Bei allem männlichen Narzissmus trieben sich Dandys gerne im androgynen Bereich zwischen festgelegten Geschlechter-Rollen herum. Spätestens mit Erfindung des „kleinen Schwarzen“ in den 1920er Jahren durch Coco Chanel trat die „Femme Dandy“ ins Rampenlicht, in Frankreich auch „Dandizette“ genannt. So trat etwa Marlene Dietrich in nobler Herrenkleidung auf, oder auch Veruschka von Lehndorff: Sie spielte 1983 die Hauptrolle im Film „Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse“ von Ulrike Ottinger.
Ohne Zuschauer keine Dandys: Daher ist die Ausstellung als Spielwiese des Voyeurismus auf vier Stationen angelegt. Von der mit Pappkameraden bevölkerten „Straße“ aus dürfen Besucher durch Gucklöcher in ein „Ankleidezimmer“ spähen. Hier werden Kleidungsstücke und accessoires, eine Krawatten-Kollektion samt -Bügler sowie Parfüms ausgebreitet: in reicher Auswahl wie beim Herrenausstatter.
Weder Definition noch Systematik
Nebenan geht es in den Salon oder gentlemen’s club: den halböffentlichen Raum fürs Schaulaufen. Wichtigstes Element ist die Nachbildung eines Bogenfensters mit Erker-Funktion. Das Original ziert das Erdgeschoss des Londoner „White’s Club“, dem traditionellen Treffpunkt der konservativen Tories. Dort konnten sich Dandys präsentieren und zugleich das Treiben auf der Straße beobachten – genau gegenüber liegt der „Brook’s Club“, das Hauptquartier der liberalen Whigs.
So flaniert die Ausstellung durch Aspekte des Dandytums, pflückt sich manches hübsche Beispiel heraus, garniert es mit geistreichen Zitaten – aber vermeidet ebenso eine konsistente Definition des Phänomens wie systematische Präsentation seiner Geschichte. Das ist verspielt und unterhaltsam, bleibt letztlich aber etwas unbefriedigend; insbesondere auf dem „Laufsteg“ in die Gegenwart.
Modenschau in Kongo-Armenvierteln
Hintergrund
Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellungen "Bart – zwischen Natur und Rasur" im Neuen Museum Berlin + "Im Dickicht der Haare" in der Grimmwelt, Kassel
und hier einen Beitrag über die Ausstellung "Blow Up – Antonionis Filmklassiker und die Fotografie" mit Veruschka von Lehndorff in der Galerie C/O Berlin.
und hier einen Bericht über die Ausstellung "Traummänner: 50 Starfotografen zeigen ihre Version vom Ideal" in den Deichtorhallen, Hamburg
und hier eine Kritik des Films "Gigola" über eine "Dandizette" im Paris der 1960er Jahre von Laure Charpentier
und hier eine Besprechung des Films "Viva Riva! – zu viel ist nie genug" – rasanter Benzinschmuggler- Krimi im kongolesischen Sapeur-Milieu von Djo Tunda wa Munga.
Einkommensschwache Sapeurs geben viel Geld für kostspielige Markenkleidung aus. Damit stolzieren sie in auffälliger Aufmachung durch ihre Wohnviertel, was als Protest gegen Armut und Elend in der Umgebung gedeutet wird; es lässt sich aber auch als eskapistischer Konsumismus unter widrigen Umständen interpretieren. Jedenfalls sind Sapeurs in leuchtend bunten Anzüge, die mit Gehstöcken und Ray-Ban-Sonnenbrillen blasierte coolness und kühle Arroganz ausstrahlen, beliebte Motive für westliche Foto-Reporter.
Hipster sind nicht elegant genug
Ein europäisches pendant stellten am ehesten die britischen ska skinheads der 1960/70er Jahre dar; sie legten ebenfalls größten Wert auf teure Klamotten und perfektes outfit. Doch in beiden Fällen handelt es sich um Subkulturen abseits der Gesellschaft. Daher finden sich heutige Spielarten des Dandytums eher etwa beim „Dandy Diary“ der Mode-blogger David Roth und Jakob Haupt, die auch das Berliner Restaurant „Dandy Diner“ betreiben.
Oder bei der schottischen performance-Künstlerin Diane Torr mit ihren „Kinging“-Auftritten als eleganter Herr. Von solchen Einzelerscheinungen abgesehen, könnten am ehesten urbane hipster die Stellung einstiger Dandys in der Mitte der Gesellschaft übernehmen – doch ihrem Auftreten mit Hornbrille und Vollbart, bemängelt Kuratorin Julia Bertschik zurecht, fehlt es leider an der nötigen Eleganz.
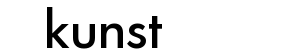

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.