
Die zweite Ausstellung ist die schwerste. Was für das zweite Buch eines angehenden Autors, das zweite Album einer Rockband oder den zweiten Film eines Jungregisseurs gilt, das trifft auch für die zweite Schau einer Kunsthalle unter neuer Leitung zu. Der novelty effect des Debüts ist weg, das Repertoire muss weiter entwickelt, aber zugleich die eigene Handschrift bewahrt werden, um das Publikum bei der Stange zu halten. Keine leichte Aufgabe, doch das Haus der Kulturen der Welt (HKW) löst sie achtbar.
Info
Als hätten wir die Sonne verscharrt im Meer der Geschichten – Fragmente zu einer Geopoetik Nordeurasiens
21.10.2023 - 14.01.2024
täglich außer dienstags 12 bis 19 Uhr
im Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10, Berlin
Handbuch gratis, Reader 21 €
Weitere Informationen zur Ausstellung
Erst sechster, jetzt neunter Teil der Erde
Während der KP-Diktatur wurde dieses Gebiet „der sechste Teil der Erde“ genannt. Mit diesen Worten waren Zeitungsseiten übertitelt, die innersowjetische Themen behandelten. Der Subtext war klar: So weit reicht unsere Herrschaft – weiter als bei jeder anderen Nation. Seit dem Untergang der Sowjetunion heißen diese Seiten „der neunte Teil der Erde“. Das wirkt etwas bescheidener, lässt aber immer noch Russlands weltumspannende Machtansprüche anklingen. In Moskau wird eifrig daran gearbeitet, das Territorium wieder auf den sechsten Teil zu erweitern.
Impressionen der Ausstellung
Kollektivierungs-Katastrophe in Kasachstan
Dem „imperialen russischen Kolonialismus“ tritt die Ausstellung explizit entgegen: Sie will die Perspektiven und Traditionen der zahlreichen Völker in dieser Weltgegend zur Geltung bringen, deren Kulturen von russischen bzw. sowjetischen Eroberungen, Deportationen und Ausrottungsversuchen unterdrückt und zerstört worden sind. Ein Dekolonisierungs-Projekt der etwas anderen Art – und dringend nötig. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hat der westliche Kulturbetrieb diesem Erbe zwar in den 1990er und 2000er Jahren einige Ausstellungen gewidmet. Doch das Interesse ist abgeflaut, weil die meisten Nachfolgestaaten abschreckend autoritär wurden, vor allem Russland selbst.
Höchste Zeit, an den kulturellen Reichtum zu erinnern, der durch den Nationalchauvinismus von Kreml und Konsorten überdeckt wird. Am vielschichtigsten und eindringlichsten gelingt das der Kasachin Almagul Menlibayeva mit ihrer Multimedia-Installation „The Tongue and Hunger. Stalin’s Silk Road“ („Zunge und Hunger. Stalins Seidenstraße“). Auf fünf Video-Kanälen wechseln heutige und Archiv-Aufnahmen, teils stark verfremdet, einander ab; dazwischen erzählen Historiker nüchtern von der Kollektivierung in Kasachstan, bei der fast die halbe Bevölkerung umkam. Eine Katastrophe wie der Holodomor in der Ukraine, nur weit weniger bekannt. Nebenan zeigt eine „postdigitale Textilarbeit“ zwölf Orte sowjetischer Verbrechen in Mittelasien an, die Menlibayeva in Videos dokumentiert hat.
Fantasievollster Beitrag ist 54 Jahre alt
So komplex ist kein anderer Beitrag, aber manche ähnlich einfallsreich. Am fantasievollsten wirkt einer, der bereits 54 Jahre alt ist. Der armenische Regisseur Sergej Paradschanow schuf – im ständigen Clinch mit der sowjetischen Zensur – eine einzigartige surreale Filmsprache; dafür bediente er sich aus dem überreichen Bilderfundus der 1700 Jahre alten Geschichte Armeniens. Ausschnitte aus seinem Meisterwerk, dem Spielfilm „Die Farbe des Granatapfels“ (auch: „Sayat Nova“) von 1969, sind auf sechs Monitoren zu sehen.
Herkömmliche Motivwelten so weiter zu entwickeln, dass sie anschlussfähig zum zeitgenössischen Kunstbetrieb werden, gelingt nicht vielen Teilnehmern. Etliche begnügen sich entweder damit, Traditionelles zu recyclen, oder sie produzieren gängige Gegenwartskunst mit folkloristischen Tupfern. Zur ersten Fraktion zählt Małgorzata Mirga-Tas. Werke der polnischen Romni waren schon auf der Berlin-Biennale und der documenta zu sehen, denn ihre bunten, figurativen Wandteppiche sind stets ein Hingucker. Doch sie zeigen meist Mitglieder ihrer Roma-Gemeinschaft in konventionellen Posen – letzlich ein banales privates Fotoalbum aus Stoffflicken.
Lieber Selbstmord, als den Zaren heiraten
Auch die Repliken kaukasischer Glas-Karaffen vom Tschetschenen Aslan Ġoisum oder der Videofilm, in dem Chingiz Aidarov Matratzen kirgisischer Wanderarbeiter aufrollt, lassen kreative Eigenanteile vermissen. Dagegen wirkt in den Video-Installationen von Anton Kats aus der Ukraine und der Tatarin Yäniyä Mikhalina, beide in geläufiger Hochglanz-Ästhetik, zumindest die Thematik ausgefallen: Kats lässt Cyber-Personen postmortal von ihrem Tod durch russischen Beschuss erzählen. Mikhalina greift die Legende einer tatarischen Prinzessin auf, die lieber Selbstmord beging, als sich mit einem Zaren verheiraten zu lassen.
Am originellsten sind jedoch Darstellungen, die inoffiziell in Dissidenten-Kreisen noch unter dem kommunistischen Einparteien-Regime entstanden sind. Etwa ein Gemälde der Moldawierin Valentina Rusu-Ciobanu von 1971, auf dem eine Familie im Fernsehen das Luna-Mondfahrzeug bestaunt – als ironischer Kommentar zur sowjetischen Fortschrittsgläubigkeit. Oder das Porträt einer Kosmonautin von Galina Konopatskaya aus Dagestan, die 1970 als „Cosmic Mother“ ihr Baby im Raumanzug wiegt. Oder die altmeisterlich ausgeführten Fantasie-Szenarien des Letten Auseklis Baušķenieks aus den 1980er Jahren voller erotisch aufgeladener Fabelwesen.
Teppiche aus Gräsern + Kräutern
Hintergrund
Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "O Quilombismo" - faszinierend vielfältige Überblicks-Schau über nichtwestliche Gegenwartskunst im Haus der Kulturen der Welt, Berlin
und hier eine Besprechung der Ausstellung "The Global Contemporary – Kunstwelten nach 1989" mit Beiträgen des russischen Künstler-Kollektivs AES im ZKM, Karlsruhe
und hier einen Beitrag über das Filmfestival "Kino der Kunst 2013" mit dem Gewinnerfilm "Transoxania Dreams" über die Austrocknung des Aral-Sees von Almagul Menlibayeva aus Kasachstan.
HKW-Chef sollte fixe Idee entsorgen
Um es zu bemerken, muss man aber davon wissen, sonst geht man womöglich achtlos vorbei. Denn diese Ausstellung krankt an der gleichen absurden Präsentation wie ihre Vorgängerin. In den Schauräumen finden sich keinerlei Angaben zu den Künstlern und ihren Arbeiten. Wer wissen will, was er vor sich hat, soll gefälligst im 160-seitigen Begleitbuch nachschlagen, das jedem Besucher an der Kasse ausgehändigt wird. Für alle, die lieber auf ihrem Smartphone-Display lesen, gibt es einen QR-Code zum Einscannen.
Diese einem Sowjet-Kommissariat würdige Informations-Verweigerung wird auch beim zweiten Anlauf nicht besser. HKW-Chef Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, der gern das Denken seiner Mitmenschen dekolonisieren möchte, sollte bei sich selbst beginnen und seine fixe Idee entsorgen, nur das Fehlen aller Schriftzeichen erlaube totale Konzentration auf Kunstwerke. Denn Begriffe ohne Anschauungen sind leer, und Anschauungen ohne Begriffe sind blind, wie wir seit Kant wissen.
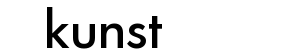

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.