
De mortuis nihil nisi bene: Am 1. März diesen Jahres starb überraschend Peter Weibel – drei Wochen vor Eröffnung der von ihm kuratierten Ausstellung „Renaissance 3.0“. Sie ist nun sein Vermächtnis geworden. Als Direktor des „Zentrums für Kunst und Medien“ seit 1999 hat er das ZKM geprägt wie kein anderer, mit all seinen Stärken und Schwächen. Sie sind in dieser Ausstellung wie unter einem Brennglas zu besichtigen.
Info
Renaissance 3.0 – Ein Basislager für neue Allianzen von Kunst und Wissenschaft im 21. Jahrhundert
25.03.2023 - 07.01.2024
mittwochs - freitags 10 bis 18 Uhr,
samstags + sonntags ab 11 Uhr
im ZKM | Karlsruhe, Lorenzstraße 19
digitaler Katalog
Weitere Informationen zur Ausstellung
Bis zu Unconventional Computing
Diese Konvergenz hat Weibel wie kein anderer im Kulturbetrieb enthusiastisch begrüßt und wortreich propagiert – selbst wenn die Grammatik manchmal auf der Strecke blieb: „Mit der Ausstellung folgen wir diesem Paradigma, nehmen Einblick in künstlerische Laborsituationen und künstlerisch-wissenschaftliche Kollaborationen, in denen unter Modellierung von Fragen, Hypothesen und künstlerisch-experimentellen Entwürfen zu Medizin, neuen Materialien und erneuerbaren Energien, Artenvielfalt und Informationsfreiheit praktiziert werden – von der Biochemie über Genetic Engineering und Informationsdesign zu den Neurowissenschaften und Unconventional Computing.“ Schließlich hängt alles mit allem zusammen.
Impressionen der Ausstellung
Forschung für Erkenntnis-Fortschritt
Entsprechend ist der Parcours, wie meist im ZKM, als lockere Folge allseits offener Räume angelegt; die Besucher mögen ihre eigenen Rundgänge wählen. Ebenso hierarchiefrei ist die Anordnung der rund 50 Beiträge: Abgesehen vom Einstieg mit einer Handvoll Faksimile der ersten und zweiten Renaissance und ein paar vagen Schwerpunkten erscheint sie recht beliebig – wie die Auswahl der Exponate.
Denn vor lauter Begeisterung für die Fusion von Kunst und Wissenschaft unterschlägt die Schau völlig, was sie unterscheidet. Dabei ist die Differenz eindeutig. Naturwissenschaft, verstanden als planmäßige Forschung, beruht auf klaren Regeln. Aus Hypothesen leiten sich Experiment-Anordnungen ab; sie müssen so gestaltet sein, dass Andere später die gleichen Versuche wiederholen können, um sie zu bestätigen oder zu falsifizieren. So dient Forschung idealiter dem Zweck kollektiven Erkenntnis-Fortschritts.
Kunst als Sphäre zweckfreier Offenheit
Kunst hingegen ist – anders als das Kunsthandwerk – per definitionem zweckfrei. Natürlich entstehen dabei Objekte, doch was und wie, bestimmt nur die subjektive Willkür des Künstlers. Er folgt keinem Masterplan kollektiven Fortschritts, auch wenn ihn die Kunstgeschichtsschreibung in der Rückschau gern postuliert. „Man kann es nur an die Wand hängen oder hinstellen und anschauen“, hat Jan Hoet, 1992 Leiter der documenta IX, einmal als Minimaldefinition eines Kunstwerks formuliert. Seine Offenheit und Unbestimmtheit macht es jedoch einzigartig: Jeder Betrachter kann es deuten, wie es ihm gefällt.
Wobei sich viele Künstler aber offenbar nach der Eindeutigkeit des Wissenschaftsbetriebs sehnen. Seit geraumer Zeit erfreut sich die Metapher vom „Erforschen“ großer Beliebtheit: In seinen Arbeiten „erforsche“ der Künstler dies oder jenes, heißt es in Katalogen oder Galerie-Werbetexten. Zwar ist diese Metapher nicht nur schief, sondern schlicht Mumpitz: Forschung läuft ganz anders ab, siehe oben.
Künstlerische Qualität scheint sekundär
Doch wer sie benutzt, erhofft sich von ihr eine Aufwertung seines Tuns. In der Schwemme vor sich hin produzierender Gegenwartskünstler empfinden sich diejenigen, die „erforschen“, wohl als seriöser und wertvoller. Ähnlich ausgerichtet, wenn auch weniger prätentiös, ist die Floskel vom „Ausloten“. Mit dem Lot wird Tiefe gemessen, meist die Wassertiefe – Künstler, die etwas „ausloten“, tragen also zur Kenntnis des Terrains bei.
Die meisten Exponate werden im ZKM präsentiert, als würden sie etwas „erforschen“ oder „ausloten“. Also sich in irgendein Wissenschafts-Programm einreihen – wobei künstlerische Qualitäten sekundär erscheinen. Angefangen mit Mikrofotografie anorganischer Stoffe von Manfred Karge, historischen Röntgenbildern aus den 1950er Jahren, die Barbara Hammer bearbeitet hat, über Filme von Plankton (Jan van IJken, Jana Winderen) bis zu Nahaufnahmen der Stimmlippen beim Sprechen (Rafael Lozano-Hemmer) – alles interessante Bilder, aber ohne kreative Zutat.
Autonomer Roboter von 1951
Ist derlei platzsparend zweidimensional, steuern andere Teilnehmer raumgreifende Installationen bei. Thomas Feuerstein füllt mit „Metabolica Camp“ einen ganzen Saal: Monströse Maschinen im Steampunk-Look sollen mithilfe von Bakterien und Algen Bio-Kunststoffe und daraus Skulpturen herstellen. Auf Hefe setzen dagegen Anna Dumitriu und Alex May bei „Fermenting Futures“: Sie soll Kohlendioxid binden und ebenso Bio-Plastik produzieren. In Glaskolben blubbert es munter – da fühlt man sich eher wie im Chemielabor oder Technik-Museum als in einer Kunst-Ausstellung.
Sind solche life-science-Apparaturen der Zukunft zugewandt, betrachten Beiträge zum Thema Computer eher deren Prähistorie. Ein Wochenschau-Film von 1951 zeigt den ersten elektronischen autonomen Roboter: „Elmer“ sucht sich den Weg in sein Häuschen so selbstständig wie heutige Rasenmäher-Roboter. Zu sehen ist auch die allererste PC-Maus von 1964: ein Holzkästchen mit roter Klick-Taste.
Lichtfluten strömen wie flüssige Aura
Hintergrund
Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "Dimensions – Digital Art since 1859" - Überblicks-Schau über High-Tech- + Digital-Kunst in den Pittlerwerken, Leipzig
und hier eine Besprechung der Ausstellung "Ryoji Ikeda: data-verse 1 + 2" – beeindruckende Digitalkunst-Projektion im Kunstmuseum Wolfsburg
und hier einen Beitrag über die Ausstellung "Bios – Konzepte des Lebens in der zeitgenössischen Skulptur" im Georg Kolbe Museum, Berlin mit Werken von Thomas Feuerstein
und hier einen Bericht über die Ausstellung "The Moderns" – Themenschau über die Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Kunst um 1900 im MUMOK, Wien.
Beides bietet auch „fluidum II“ von Holger Förterer. Laufen Besucher an einer Bildwand vorbei, werden ihre Bewegungen in Lichtfluten übersetzt, die hinter den Personen her strömen, als seien sie eine Art flüssiger Aura. Nebenan gelingt dem Kollektiv „robotlab“ tatsächlich der Brückenschlag zwischen Hochtechnologie und Kunst: Es lässt einen „Kuka“-Industrieroboter Fotos von der Marsoberfläche abzeichnen. Mit einem Endlos-Strich, ohne abzusetzen – dennoch sieht das Ergebnis für menschliche Augen verblüffend naturgetreu aus.
Auf zum nächsten Projekt
So breitet diese Ausstellung noch einmal die wichtigsten Merkmale der Methode Weibel aus: alles Mögliche heranzuschaffen, aneinander zu reihen und mit Schlagworten zu etikettieren – darauf setzend, dass es sich irgendwie erhellen möge. Eine Hoffnung, die häufig trog; aber da war Weibel schon weiter und mit dem nächsten Projekt beschäftigt. Derart umtriebig und hyperaktiv wie er war kaum einer. Was diese Schau getreulich spiegelt; insofern ist sie ein würdiges Vermächtnis. Und fortan bitte fokussierter!
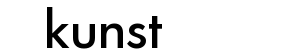

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.