
„Every nigga is a star“: Diese Eingangszeile von Kendrick Lamars epochalem Album „To Pimp a Butterfly“ (2015) hätte einen treffenden Titel für diese Ausstellung abgegeben – nennt sie doch bündig das unterschwellige Heilsversprechen, das Hip-Hop seit seinen Anfängen transportiert. Aber „The Culture“ passt auch gut: durch die großmäulige Lakonie, mit der sich diese Subkultur zu DER maßgeblichen Kulturströmung unserer Zeit stilisiert.
Info
The Culture - Hip-Hop und zeitgenössische Kunst im 21. Jahrhundert
29.02.2024 - 26.05.2024
täglich außer montags 10 bis 19 Uhr,
mittwochs + donnerstags bis 22 Uhr
in der Schirn Kunsthalle, Römerberg, Frankfurt am Main
Katalog 45 €, Broschüre gratis
Weitere Informationen zur Ausstellung
Mongolischer Hip-Hop-Star auf Kamel
Doch der Ausstellung in der Schirn Kunsthalle fehlt ein Sinn für weit ausgreifende Zusammenhänge. Vom Baltimore Museum of Art und dem Saint Louis Art Museum konzipiert, wird sie nun etwas verschlankt in Frankfurt gezeigt. Nichtsdestoweniger ist sie mit mehr als 100 Exponaten üppig bestückt, jedoch völlig auf US-Hip-Hop fixiert. Die übrige Welt kommt nur auf drei Fotos vor: zwei aus Frankreich, wo les rappeurs enorm populär sind, und einem aus der Mongolei – ein dortiger Star-Rapper sitzt auf einem Kamel. Alles klar: Nichtamerikanischer Hip-Hop gilt als Kuriosum.
Feature zur Ausstellung. © Hessenschau
Einfühlsamer + bewegender Bildteppich
Genauer: Die Schau interessiert sich allein für schwarzen Hip-Hop. Weiße und stilistisch einflussreiche Weltstars wie Eminem oder die Beastie Boys finden allenfalls in der Chronik der Bewegung kurz Erwähnung. Wie selbstverständlich wird Hip-Hop allein als authentisches Medium schwarzer Selbstermächtigung verstanden; entstanden in Großstadt-Ghettos der 1970er Jahre, um Benachteiligung und Diskriminierung kreativ auszuhebeln.
Betextet im politisch korrekten Kunstbetriebs-Jargon und wörtlich übersetzt, bringt das schöne Stilblüten hervor, etwa: Schwarze Musik-“Genres waren historisch betrachtet immer Instrumente des Widerstands gegen die Gesellschaft, die kontinuierlich versuchte, Schwarze Arbeit unsichtbar zu machen oder von ihr zu profitieren.“ Oder: Ein Videoclip „macht sich Kinematografie, Choreografie und gefundenes Filmmaterial zunutze, um komplexe und festgefahrene Vorstellungen von Männlichkeit in einem einfühlsamen und bewegenden Bildteppich aus Schwarzer Liebe und Leben zu erkunden.“
Opulente Oberflächenreize
Dass zwei US-Museen pro domo argumentieren, wobei sie ausgiebig lokale Musiker und Künstler featuren, kann man ihnen kaum vorhalten. Dass die Schirn keine Anstalten macht, ihre Ausstellung fürs hiesige Publikum zu modifizieren, hingegen schon. Stattdessen setzt sie auf attraktiv inszenierte Schauwerte: Bereits der Auftakt verblüfft mit großformatigen, farbenprächtigen Ölbildern von Rap-Stars und solchen, die es gern wären – Frauen in genreüblich lasziven Posen, Männer mit ebenso geläufigen Macho-Gesten.
Opulente Oberflächenreize prägen auch die übrigen Abteilungen. Dabei legt die Schau viel Gespür für Originelles an den Tag, weil sie ganz der Binnenperspektive von Hip-Hop verpflichtet bleibt – doch sie unterlässt es völlig, ihn im Kontext der übrigen Welt zu verorten und dazu naheliegende Fragen zu stellen. Etwa zur Mode: Da sind fantasievolle Design-Variationen von Trainingsanzügen und Turnschuhen zu sehen. Doch warum gerade diese Kombination seit Jahrzehnten die klassische Hip-Hop-Kluft ausmacht, bleibt undiskutiert.
Goldketten für den Sklavenhandel
Bereits Rock’n’Roll hatte mit T-Shirt, Jeans und Lederjacke typische Arbeiterkleidung popularisiert; erst bei Mittelklasse-Kids, dann der Gesamtbevölkerung. Für sie haben Hip-Hopper ebenso ästhetische Standards definiert; mit Unterschichts-Sportkleidung, die während der Anfangstage von Breakdance in den 1980er Jahren einfach praktisch gewesen sein mag. Doch wieso hält Hip-Hop daran fest, während Rockmusiker nach wenigen Jahren stilistisch wild herumexperimentierten? Weil Rapper letztlich einen konventionellen Geschmack haben? Oder konservativ eine peer group-Uniform befürworten?
Die Sektion „Schmuck“ glänzt gleichfalls durch ausgesuchte Pretiosen; etwa schreiend bunte Kunsthaar-Perücken der Rapperin Lil‘ Kim, eine reliefartige Assemblage aus Durag-Kopftüchern von Anthony Olubunmi Akinbola oder funkelnde Verzierungen auf Goldzähnen, so genannte grillz, mit dem Schriftzug „Black Power“ von Hank Willis Thomas. Doch über reine Glitzereffekte gehen nur wenige Beiträge hinaus, wie der von Robert Pruitt: Er zeichnet mit Goldketten die Routen des transatlantischen Sklavenhandels nach.
Grundwiderspruch einer Ex-Subkultur
Die Omnipräsenz von Goldschmuck im Hip-Hop konstatiert auch die Ausstellung – und belässt es dabei. Liegt das nur an der Prunksucht von Parvenus? Oder schimmern dabei auch althergebrachte Repräsentations-Rituale in Afrika durch? Dort statten sich traditionelle Würdenträger wie obas (Könige) häufig mit reichlich Gold aus; je mehr und massiver, umso besser. Wenn dafür die Mittel nicht reichen, greift man zu golden schimmernden Messingguss-Objekten.
Für all das braucht man viel Kohle. Dass Hip-Hop vor allem eine milliardenschwere Unterhaltungsindustrie ist, verschweigt die Schau nicht – und zitiert den Star Jay-Z: „I’m not a businessman, I’m a business, man!“. Doch anschließend häuft sie nur Statussymbole und Memorabilia an, anstatt den Grundwiderspruch zu beleuchten: Eine ehemalige Subkultur behauptet bis heute, Sprachrohr der Erniedrigten und Beleidigten zu sein – derweil scheffeln ihre führenden Protagonisten Geld wie Heu und stellen einen obszön protzigen Lebensstil zur Schau.
Kriminelle Prekariats-Fantasie
Diese Doppelmoral veranschaulicht treffend ein Videofilm von Larry W. Cook: Ein schwarzer Lamborghini dreht sich mit heulendem Motor im Kreis, angefeuert von Hip-Hoppern – und unterlegt von Auszügen der legendären „I Have a Dream“-Rede 1963 von Martin Luther King. Leer laufende Luxusautos als Traumziel der Bürgerrechtsbewegung; der ironisch-zynische Hypermaterialismus dieser Metapher ist atemberaubend.
Doch er passt blendend zu dem Subgenre, das Hip-Hop seit den 1990er Jahren dominiert: Gangsta-Rap. Die kommerziell erfolgreichste Strömung ist zugleich die inhaltlich und musikalisch simpelste. Mit Drogenhandel und Waffengewalt kommen Oberchecker im Nu zu jeder Menge Asche, prassen rum und legen alle Frauen flach – so oder ähnlich lautet die Botschaft der meisten tracks. Also eine kriminelle Prekariats-Fantasie vom Reichtum ohne Mühe und Reue, deren geistige Schlichtheit sich kaum unterbieten lässt.
Mit Hypersexualität gegen Machos
Regelverstöße gehören seit jeher zum Reiz von Jugendkulturen, sonst bräuchte man sie nicht. Dennoch erstaunt, wie hartnäckig Gangsta-Rap seit mehr als drei Dekaden mit seiner Unterwelt-Glorifizierung Abermillionen von Fans begeistert. Was eklatant der Selbststilisierung von Hip-Hop widerspricht, die Bewusstwerdung und Befreiung der Deklassierten zu befördern. Den Mythos vom „unermüdlichen Kampf Schwarzer Menschen gegen Rassismus, Sexismus und Marginalisierung“ spinnt auch die Schau fort, indem sie eine Songzeile des 1996 ermordeten Rappers Tupac Shakur prominent zitiert: „They got money for wars, but can’t feed the poor.“ Über diesen Schwarzweiß-Befund ist Hip-Hop seither kaum hinausgekommen.
Ein weiterer Selbstwiderspruch im Hip-Hop zeigt sich beim Geschlechterverhältnis. Einerseits ist es seit seinen Anfängen immer wieder starken Frauen gelungen, sich im vom Machismo dominierten Milieu durchzusetzen und zu Stars aufzusteigen. Andererseits bedienen sie sich dazu häufig hypersexualisierter Klischees, die Feministinnen normalerweise schaudern lässt.
„Pussy Power“ einer „Boss Bitch“
Hintergrund
Lesen Sie hier eine Rezension ds Films "Rheingold" – gelungenes Biopic eines Gangsta-Rappers von Fatih Akins
und hier eine Besprechung des Films "All Eyez on me" – gelungenes Biopic über den Rapper Tupac Shakur von Benny Boom
und hier einen Bericht über die Ausstellung "Basquiat: Boom for Real" – große Werkschau des Graffiti-Künstlers Jean-Michel Basquiat in der Schirn Kunsthalle, Frankfurt am Main
und hier einen Beitrag über die Ausstellung "Ikonen – Was wir Menschen anbeten" – facettenreiche Themenschau mit Hip-Hopper-Porträts von Kehinde Wiley in der Kunsthalle Bremen.
All das ignoriert die Ausstellung; es ist ihr wohl zu heikel. Auch die eminente Bedeutung von Sprache im Hip-Hop – dessen oft fabulierende und anspielungsreiche lyrics quasi die gesellschaftliche Rolle ausfüllen, die früher juveniler Dichtung zukam – wird nur ansatzweise gewürdigt; etwa mit zwei dürftigen Beispielen für die aus dem Sprühen von Graffiti hervorgegangene Street Art. Obwohl solche Werke längst ein eigenes, viel beachtetes Segment des Kunstmarkts bilden.
Viele unbeantwortete Fragen
Dagegen widmen die Macher dem „Tribut“, also gegenseitigen Ehrenbezeugungen, und dem „Aufstieg“ im Sinne von Auferstehung und Weiterleben nach dem Tod viel Raum. Dass darin existenzielle Unsicherheit zum Ausdruck kommt – vielleicht sogar von Todesnähe, die mit Knarren herumfuchtelnde Drogendealer aushalten müssen –, machen mehrere Arbeiten anrührend deutlich. Wovon sie geprägt sind, etwa christlicher Sozialisation, wird aber nicht thematisiert.
Denn die Schau bleibt strikt der Selbstreferenzialität von Hip-Hop verpflichtet, seiner Selbstbeschreibung und -deutung. Dieses geistige Ghetto verlässt sie nicht; dadurch wirft sie für Außenstehende etliche Fragen auf, die sie unbeantwortet lässt. „The Culture“ tippt als Pioniertat manche bedeutsame Merkmale von Hip-Hop allenfalls an. Nun sollten weitere Ausstellungen den Faden aufgreifen und die Analyse vorantreiben: Was sagen dessen Eigenheiten eigentlich über den Zustand unserer Gegenwart und ihre Kunst aus?
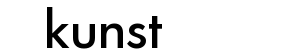

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.