
In der DDR war Kunst nicht einfach nur Kunst. Sie stand in der Regel in einem politischen Kontext; sei es als Affirmation des staatlichen Systems oder als Kritik daran – oder als ganz bewusstes Außen-vor-Lassens des gesellschaftlichen Rahmens.
Info
Re-Connect. Kunst und Kampf im Bruderland
täglich außer montags 10 bis 18 Uhr,
mittwochs 12 bis 20 Uhr
im Museum der bildenden Künste, Katharinenstraße 10, Leipzig
Katalog 39,90 €
Weitere Informationen zur Ausstellung
Oktett ausländischer Kunst-Studenten
Dieser Aspekt ist bei der Beschäftigung mit der ostdeutschen Kunstgeschichte bislang ignoriert worden. Ein blinder Fleck, den Museum der bildenden Künste (MdbK) mit der dreiteiligen Ausstellung „Re-Connect. Kunst und Kampf im Bruderland“ ausleuchten will. Im ersten Teil werden rund 80 Arbeiten von acht ausländischen Künstlern gezeigt, die in der DDR studiert haben – bzw. im Fall von Semir Alschausky: dessen sudanesischer Vater.
Feature zur Ausstellung. © Museum der bildenden Künste Leipzig
Wahlheimat ist wichtiger als Agitation
Da ihre Migranten-Biografie das entscheidende Kriterium bei der Auswahl war, ergibt das zwangsläufig einen sehr heterogenen Mix an Werken und Techniken. Dabei spielt der „sozialistische“ Aspekt eine weit geringere Rolle, als der Ausstellungstitel vermuten lässt. Erstens sind etwa die Hälfte aller Arbeiten nach 1990 entstanden, also nach dem Ende der DDR. Zweitens dominieren auch bei früheren Werken eher persönliche und unpolitische Themen: Die Auseinandersetzung mit der fremden Wahlheimat spielt eine größere Rolle als Agitation.
Mit einer Ausnahme: César Olhagaray wurde in Chile vom Pinochet-Regime verfolgt und erhielt 1974 politisches Asyl in der DDR, wo er in Dresden bildende Kunst studierte. In zwei düsteren Grafiken von 1975 stellt er seine Gefangenschaft im berüchtigten Nationalstadion dar, wo die Junta nach dem Putsch politische Gegner einsperrte und folterte. Ein farbenfrohes Plakat von 1983 verkündet den Widerstands-Slogan „Venceremos!“ („Wir werden siegen!“) zusammen mit linken Nationalheiligen wie dem Dichter Pablo Neruda oder dem Sänger Victor Jara. Olhagarays aktuelle Arbeiten wirken wie eine Neuinterpretation der Höllenbilder von Hieronymos Bosch.
Gekommen, um zu bleiben
Auch die frühen Arbeiten des Äthopiers Getachew Yossef Hagoss, Absolvent der HGB Leipzig, fallen eher politisch aus. Sein Plakat „Afrika mit weinender Maske“ (1984) zeigt den Kontinent als Trauermaske vor Regenbogenfarben. Beeindruckender wirken jedoch das beklemmende Selbstporträt: „Leben im Betondschungel“ (1987) oder ein Kleinformat voller Vögel mit aufgerissenen Schnäbeln („Ausbrechen“, 1991). Sie deuten die Probleme bei der Assimilation im Leben zwischen zwei Welten an.
Ähnlich verhält es sich bei den farbenfroh figurativen Arbeiten der Ägypterin Mona Ragy-Enayat mit stilisierten menschlichen Gestalten samt auffallend großen Augen. Schon der Werktitel „Ich weiß, dass ich ohne Heimat bleibe. Ich weiß, dass ich mein eigenes Schicksal bin.“ (2007) spricht Bände. Allerdings lebt die Künstlerin bis heute in Leipzig, wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen.
Junge migrantische Künstler im Wettbewerb
Nach 1990 entstandene Bilder von Solomon Wija aus Äthiopien zeigen, dass Gefühle von Einsamkeit und Ausgeschlossensein nicht von einem politischen System abhängen: Auf „Die sind anders“ (1996/97) dominiert eine abstrahierte und isolierte Person – vergleichbar mit dem figurativen Gegenstück „Erster sein“ (2022). Visuell am stärksten erscheinen hingegen Arbeiten, die von jedem DDR-Bezug weit entfernt sind. Semir Alschausky füllt riesige Papierbögen mit filigranen grafischen Mustern und geometrischen Figuren, die sich durch präzises Gespür für Komposition und Rhythmus auszeichnen.
Quasi als Fortsetzung des Auftakts mit Kunst von Migranten in der DDR hat das Museum im Vorfeld der Ausstellung einen Wettbewerb für junge Künstler migrantischer Herkunft ausgerichtet. Dieser zweite Teil unterscheidet sich deutlich von den konventionelleren Tafelbildern der älteren Generation. Abstrakte bis hermetische Installationen sind ohne Erläuterungen im Katalog kaum zugänglich. Eine Ausnahme bildet „Garcías Tochter“: In dieser Fotoserie spürt Alina Simmelbauer ihrem unbekannten Vater nach. Sie wuchs ohne den Vertragsarbeiter auf, der nach der Wende in seine kubanische Heimat zurückgekehrt war.
100.000 Vertragsarbeiter in 1989
Hintergrund
Lesen Sie hier eine Rezension der Ausstellung "Point of No Return – Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst" im Museum der bildenden Künste, Leipzig
und hier eine Besprechung der Ausstellung "Hinter der Maske – Künstler in der DDR" – umfassende DDR-Überblicks-Schau im Museum Barberini, Potsdam
und hier einen Beitrag über die Ausstellung "Ostdeutsche Malerei und Skulptur 1949 – 1990" – durchdachte Präsentation kontroverser DDR-Kunstwerke im Albertinum, Dresden.
Vertragsarbeiter wurden in den 1970/80er Jahren aus Drittweltländern in die DDR geschickt, um dort im Niedriglohnsektor zu arbeiten – ähnlich den südeuropäischen Gastarbeiter, die ab den 1960er Jahren in die Bundesrepublik einwanderten. Ende 1989 lebten geschätzt 100.000 junge Vertragsarbeiter in der DDR; die meisten aus Vietnam, kleinere Gruppen kamen aus Mosambik, Angola und Kuba.
Abschottung + Alltagsrassismus
Viele von ihnen trieb die Hoffnung auf eine Ausbildung und guten Verdienst nach Europa. Stattdessen erwarteten sie staatliche Gängelei, Abschottung von der ostdeutschen Bevölkerung und Alltagsrassismus. Sie wurden oft bei monotonen und schlecht bezahlten Tätigkeiten eingesetzt, weil sich dafür nicht genug einheimische Arbeitskräfte fanden. Nach der Wende gerieten diese ohnehin kaum sozial geschützten Ausländer oft in die Wirren der Übergangsphase. Da in ihren Herkunftsländern die Zukunft mindestens genauso unsicher war, entschieden sich trotzdem viele für ein Verbleiben im wiedervereinigten Deutschland.
Wenn man sich von der schieren Materialfülle nicht abschrecken lässt, eröffnet dieser Ausstellungsteil neue Perspektiven auf einen wenig bekannten Teil der DDR-Wirklichkeit, der bis heute unterbelichtet ist. Im Gegensatz zur internationalistischen Ideologie wurden die Vertragsarbeiter wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in den 1990er Jahren haben unter anderem hier ihre Wurzeln.
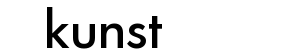

 .
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
.
Diesen Button „Leseansicht umschalten“ bitte drücken. Alternative: Zum Aktivieren der
Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
 . Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.
. Diesen
Button „Plastischen Reader aktivieren“ bitte drücken. Alternative: Ist dieser Button nicht
vorhanden, geben sie in der Adresszeile vor der URL manuell das Wort „read:“ ein und drücken sie
die Return-Taste. Dann erscheint dort „read://https_kunstundfilm.de...“. Alternative: Zum
Aktivieren der Leseansicht drücken Sie die Taste F9.